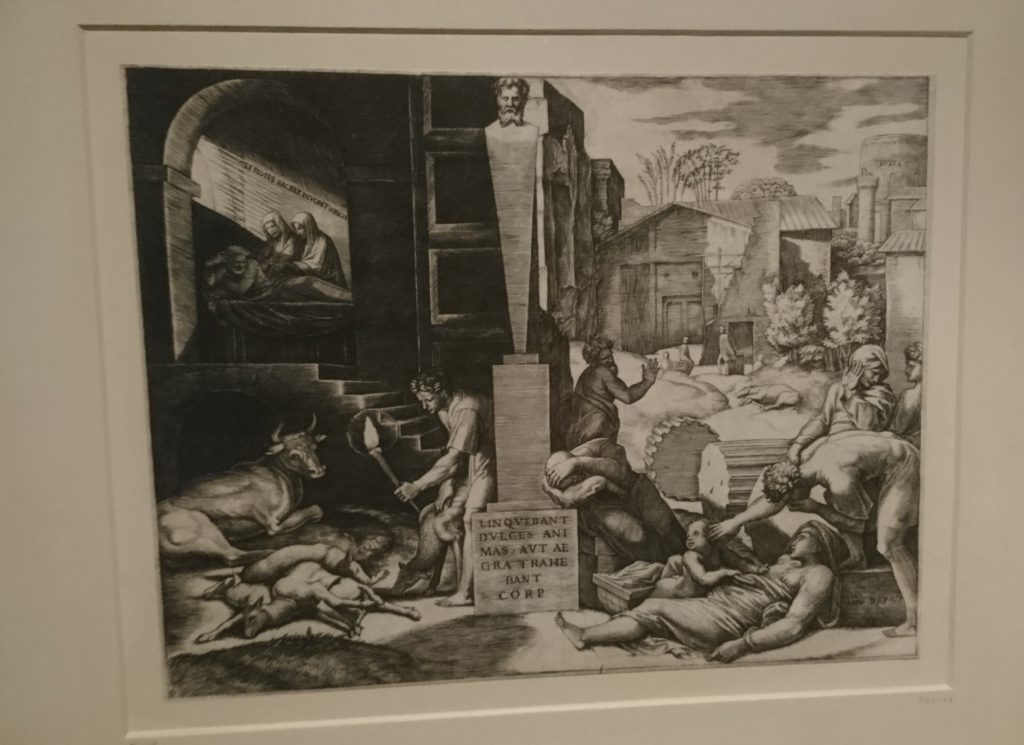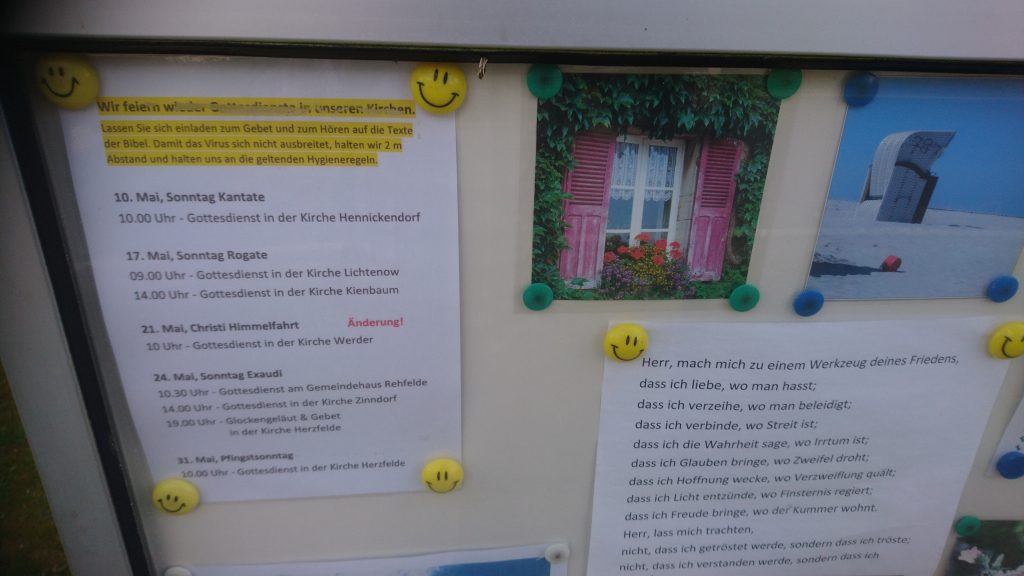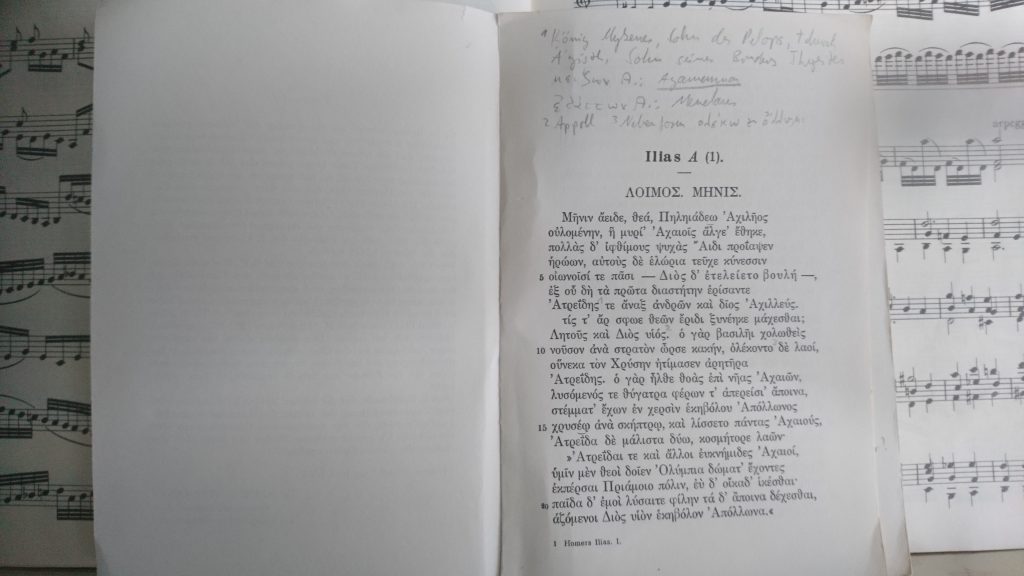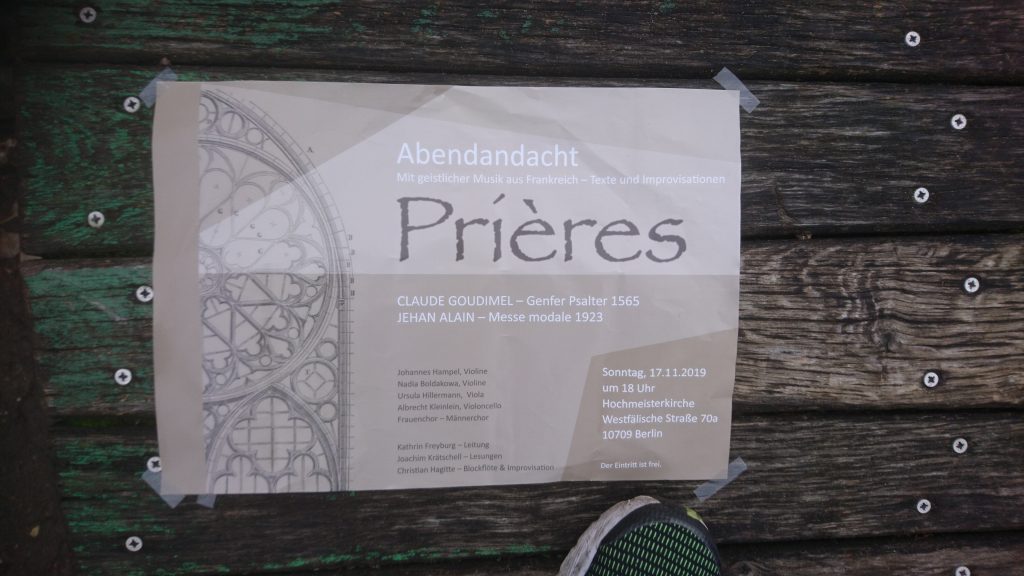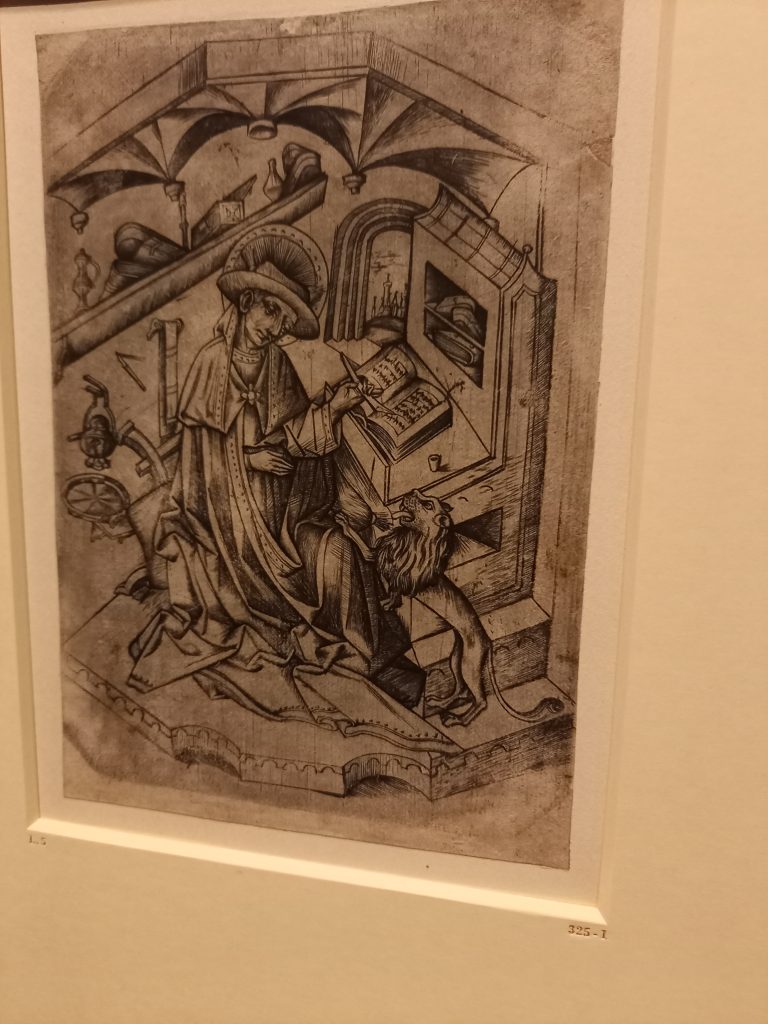
Say something back
How do you think dying thoughts
when finally the wind
between silence and echo
kisses you with promises of tomorrow?
When suddenly the rose in the front garden
freed from the hollow of winter laughs yellow?
Who thinks about shovels digging black earth
when in the park couples linger
lying on sun warmed grass not beneath?
When children clap at the sight of a swan
not twisting its neck not plucking it naked?
By the window overlooking the garden
where you buried a kit fox last summer
you’re thinking of making home
making love checking his heart beat
*In response to Cardiomyopathy by Denise Riley in Say Something Back
Entnommen aus: Petra Hilgers: The heart neither red nor sweet.
erbacce-press, Liverpool UK 2021, ISBN: 978-1-912455-21-8
Mich erreichte im Juli aus Immenstadt die Anfrage, ob ich wohl einige Gedichte der Autorin Petra Hilgers aus dem Englischen übersetzen möchte. Ich las die beigelegten Texte durch und war auf der Stelle stark beeindruckt von diesen Gedichten! Sie schlugen sofort verschiedene Saiten in mir an. Eine Übersetzung ins Deutsche wäre ein Versuch, diese verschiedenen Saiten in einen Zusammenklang zu bringen und damit auch das englische Original zu stärkerem Schwingen zu bringen. Ich war sofort und ohne Einschränkung bereit, zu dem Vorhaben beizutragen, diese auf Englisch verfassten Gedichte der in Deutschland geborenen Petra Hilgers ins Deutsche zu übersetzen.
Nach einigen Stunden, Tagen, Wochen des Sinnens, Nachsinnens, Singens entstand folgende Übersetzung, die ich der Autorin vorlegte, und der sie mit einigen wenigen Änderungen ihren Segen gab:
Sag etwas zurück
Wie denkst du sterbende Gedanken
wenn schließlich der Wind
zwischen Stille und Echo
dich küsst mit Verheißungen von morgen?
Wenn die Rose im Vorgarten
befreit von der Höhlung des Winters plötzlich gelb auflacht?
Wer denkt an Schaufeln die sich in schwarze Erde graben
wenn müßige Paare im Park
auf sonnwarmem Gras liegen nicht darunter?
Wenn Kinder beim Anblick eines Schwans klatschen
ihm nicht den Hals umdrehen ihn nicht nackt rupfen?
Am Fenster mit Blick auf den Garten
in dem du letzten Sommer einen Fuchswelpen begraben hast
denkst du daran ein Zuhause zu schaffen
Liebe zu machen seinen Herzschlag zu prüfen
*Als Antwort auf Cardiomyopathy von Denise Riley in Say Something Back
Das Bild oben zeigt den Hl. Hieronymus in der Schreibstube. Kupferstich entstanden um 1435-1440. Als Urheber gilt der sogenannte Meister des Todes Mariae. Staatliche Museen Berlin, Kupferstichkabinett. Das Blatt ist noch bis 3. Oktober zu sehen in der Ausstellung: Spätgotik. Aufbruch in die Neuzeit. Berliner Gemäldegalerie