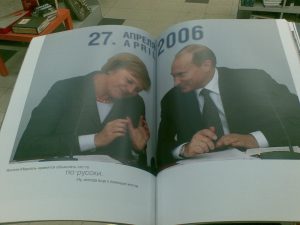Die allermeisten, die sich mit entschiedenen Ansichten zur Integrationsdebatte äußern, beziehen ihr Wissen aus zweiter Hand. Sie folgen vorgefertigten Bahnen, haben nicht auf eigene Faust Erfahrungen in migrantisch dominierten Vierteln und migrantischen Familien gesammelt. Und die eigenen Kinder schicken sie bewusst auf Schulen, in denen Migranten die Minderheit darstellen. Die meisten Politiker und Journalisten sitzen mangels eigener Anschauung wieder und wieder denselben Irrtümern auf. Welchen?
1. Irrtum: Die Zuwanderer aus Ländern wie der Türkei oder dem Libanon seien individuell, als Einzelpersonen, aufgebrochen, um „anderswo ihr Lebensglück zu machen“. So schreibt es soeben wieder einmal der Berliner Tagesspiegel. Nichts wäre irreführender als das heute anzunehmen! Es handelt sich heute fast durchweg um Gruppenmigration. Aus einer Gruppe – in eine Gruppe hinein! Ein Anreiz zur Integration im neuen Land besteht foglich zumeist nicht. Richtig ist: Menschengruppen, die im Herkunftsland keinerlei Perspektive auf Wohlstand und Versorgung haben, brechen auf Beschluss einiger führender Männer auf und wandern als Kollektive auf einmal oder nach und nach in die Bundesrepublik ein. Diese Kollektive verstärken sich durch den Zuzug von Ehepartnern aus den Herkunftsländern laufend neu, bauen gut miteinander vernetzte, autarke Zusammenhänge auf. Diese sich ständig erweiternden Netzwerke in die bestehende deutsche Mehrheitsgesellschaft einbauen zu wollen, halte ich mit den bisherigen Methoden der Integrationspolitik für ausgeschlossen. Die zuwandernden Menschen haben auch nichts weniger im Sinn als dies. Die Integration in die deutsche Mehrheitsgesellschaft würde ja ein Aufbrechen der bisherigen Versorgungsgemeinschaft bedeuten, würde zusätzliche Risiken bergen.
Hier bedarf es einer stärkeren Einfühlung in die Mentalität und die Interessen der Zuwanderer. Sie empfinden subjektiv meist keine Notwendigkeit, sich individuelle Perspektiven zu erarbeiten, sondern sind mit dem Staus quo mehr oder minder zufrieden.
Ein Aufbrechen dieses Zusammenhangs ist meines Erachtens nur über eine strenge zeitliche Befristung der Sozialhilfe für Angehörige anderer Staaten zu erreichen. Nach einem relativ kurzen Zeitraum, etwa nach 6-12 Monaten, muss die Sozialhilfe für Zuwanderer mit fremder Staatsangehörigkeit automatisch auslaufen – mit dieser klaren, vor der Einreise mitgeteilten Ansage würde endlich ein deutlicher Anreiz gesetzt, sich durch Arbeit zu integrieren.
Der vielbeschworene „Aufstiegswille“, wie ihn neuerdings etwa Klaus Wowereit fordert, lässt sich meines Erachtens nur durch den termingenauen Fortfall der Sozialhilfe erzielen. Ich sehe keinen anderen Weg.
Als Vorbild dafür müssten die Clinton’schen Sozialreformen des Jahres 1996 dienen. Die zeitliche Beschränkung der Sozialhilfe durch die beiden Sozialgesetze Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act“ (PRWORA) und Temporary Assistance to Needy Families“ (TANF) führten wie angestrebt zu einem deutlichen Rückgang der Kinderarmut und zu einem Rückgang der Zahl der sozial benachteiligten unverheirateten Mütter. Und vor allem verhinderten die Sozialreformen des Jahres 1996, dass weiterhin in großem Umfang eine hohe Kinderzahl als Quelle von Einkommen durch Sozialhilfe ausgenutzt wurde.
2. Irrtum: Der zweite große Mangel der deutschen Migrationsdebatte besteht darin, dass systematisch die Politik der Herkunftsländer vernachlässigt wird. Die Regierungen der Türkei, Lybiens und Syriens hatten und haben ein Interesse daran, bestimmte Bevölkerungsschichten loszuwerden. Das haben insbesondere die Wissenschaftler Stefan Luft und Ralph Ghadban herausgearbeitet. Diese Staaten kommen so um die Notwendigkeit herum, selbst funktionierende Sozialsysteme aufzubauen, und können ihre eigene Problembevölkerung in Deutschland „unterbringen“ oder „abschieben“. Darüber hinaus nutzt ein Staat wie die Türkei diese „untergebrachte“ Bevölkerung sehr geschickt als Hebel, um eigene machtpolitische Ambitionen voranzutreiben und willkommene Devisen zu erringen.
Ich meine: Hier ist unbedingt der offene Dialog mit den Regierungen der Türkei, des Libanon und Syriens zu suchen. Grundfrage muss sein: „Warum schickt ihr eure Landsleute zu uns? Was sind eure Interessen? Warum baut ihr kein Sozialversicherungssystem auf, das dem deutschen vergleichbar ist?“
3. Irrtum: Der dritte Irrtum lautet: „Diese zugewanderten Menschen sind sozial schwach und benachteiligt.“ Dies mag vielleicht gegenüber dem deutschen Durchschnitt gelten. Gegenüber den Bedingungen in den Herkunftsländern stellt aber eine Hartz-IV-Existenz einen bedeutenden materiellen Gewinn und auch eine im Ursprungsland unerreichbare finanzielle Sicherheit dar. Die Sogwirkung des deutschen Sozialstaates besteht ungemindert, zumal da die deutsche Sozialpolitik weiterhin einen zweiten klug bedachten, weiterführenden Umbau des Systems scheut.
Hier ist insbesondere die Axt an die mittlerweile blühende Migrations- und Sozialindustrie zu setzen. Mir hat einmal eine Berliner Sozialarbeiterin erzählt, wie sie zwei Mal versuchte, mit einem türkischen, von Sozialhilfe lebenden Vater, der hier in Berlin aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, über Probleme mit einem Kind zu sprechen. Es war nicht möglich. Der Vater verstand auf Deutsch nicht, worum es ging. Auf Kosten des Staates musste zu den folgenden Gesprächen ein türkischer Dolmetscher beigezogen werden. Ein Fall von tausenden! Die Sozialarbeiter, die Berater, die Bewährungshelfer, die Dolmetscher usw., die unglaubliche Vielzahl an staatlich geförderten Initiativen, Vereinen, Beratungsstellen, Therapeuten usw. haben sich zu einer üppigen steuerfinanzierten Industrie ausgewachsen, die nichts mehr fürchtet als den Fortfall ihrer „Stammkundschaft“. Folglich verstehen die Vertreter dieser Industrie nichts besser, als unablässig die Öffentlichkeit von ihrer Unverzichtbarkeit zu überzeugen.
Ich rate zur Zurückführung der staatlichen Beratungs- und Förderleistungen. Sie sind aufs Ganze gesehen eher kontraproduktiv, weil sie Hilfeempfänger heranzüchten und Selbsthilfekräfte lähmen.
Das freigewordene Geld sollte zukunftsfähig investiert werden.
(Serie wird fortgesetzt.)
Kommentar aus dem heutigen Tagesspiegel:
Die Richtung geht verloren
Es waren und sind die Enkel von Migranten aus der Türkei, die oft genug mit so schlechten Deutschkenntnissen in die Schule kommen, dass ihr Weg in die Sackgasse schon in der ersten Klasse besiegelt wird. Sie sind Opfer der Illusionen von Bewegung ohne Veränderung, die ihre Eltern meist hilflos, die religiösen und politischen Führer in der Türkei oft genug sehr machtbewusst pflegen. Ihre Richtung aber hat die moderne Migration verloren, weil die Mehrheitsgesellschaften selbst vergessen haben, dass individuelles Menschenrecht und Demokratie eine unübertreffliche Orientierung für Menschen sind, die aufbrechen, um anderswo ihr Lebensglück zu machen.
 „So, jetzt weißt du endlich, wie eine türkische Mutti sich beim Elternabend in einer Berliner Grundschule fühlt!“ flüsterte ich mir zu, als ich gestern den Elternabend unserer russisch-deutschen Grundschule besuchte. Man kommt zwar mit, aber man traut sich nicht, selber was in der Fremdsprache zu sagen. So ging es mir gestern. Es war aber eher ein „Eltern-Nachmittag“. Egal, jedenfalls fand die erste Hälfte auf Deutsch, die andere auf Russisch statt. Ich war der einzige, der nicht fließend wie ein Muttersprachler Russisch spricht. Und ich fragte meinen Nachbarn: „Was heißt eigentlich udarenie?“ – „Betonung! Haben Sie einen Stock, um die richtige Betonung zu vermitteln?“ Die Lehrerin sagt: „Die Kinder haben oft Schwierigkeiten mit der Betonung. Achten Sie auf die richtige Betonung!“ Wir Eltern sind aufgefordert, auf die sprachliche Entwicklung unserer zweisprachigen Kinder noch mehr zu achten, mit ihnen noch mehr zu üben. Fließendes Lesen in beiden Sprachen müssen die Kinder demnächst beherrschen. Dabei sollen wir Eltern auch mitarbeiten. Elterliche Unterstützung wird erwartet und eingefordert.
„So, jetzt weißt du endlich, wie eine türkische Mutti sich beim Elternabend in einer Berliner Grundschule fühlt!“ flüsterte ich mir zu, als ich gestern den Elternabend unserer russisch-deutschen Grundschule besuchte. Man kommt zwar mit, aber man traut sich nicht, selber was in der Fremdsprache zu sagen. So ging es mir gestern. Es war aber eher ein „Eltern-Nachmittag“. Egal, jedenfalls fand die erste Hälfte auf Deutsch, die andere auf Russisch statt. Ich war der einzige, der nicht fließend wie ein Muttersprachler Russisch spricht. Und ich fragte meinen Nachbarn: „Was heißt eigentlich udarenie?“ – „Betonung! Haben Sie einen Stock, um die richtige Betonung zu vermitteln?“ Die Lehrerin sagt: „Die Kinder haben oft Schwierigkeiten mit der Betonung. Achten Sie auf die richtige Betonung!“ Wir Eltern sind aufgefordert, auf die sprachliche Entwicklung unserer zweisprachigen Kinder noch mehr zu achten, mit ihnen noch mehr zu üben. Fließendes Lesen in beiden Sprachen müssen die Kinder demnächst beherrschen. Dabei sollen wir Eltern auch mitarbeiten. Elterliche Unterstützung wird erwartet und eingefordert.