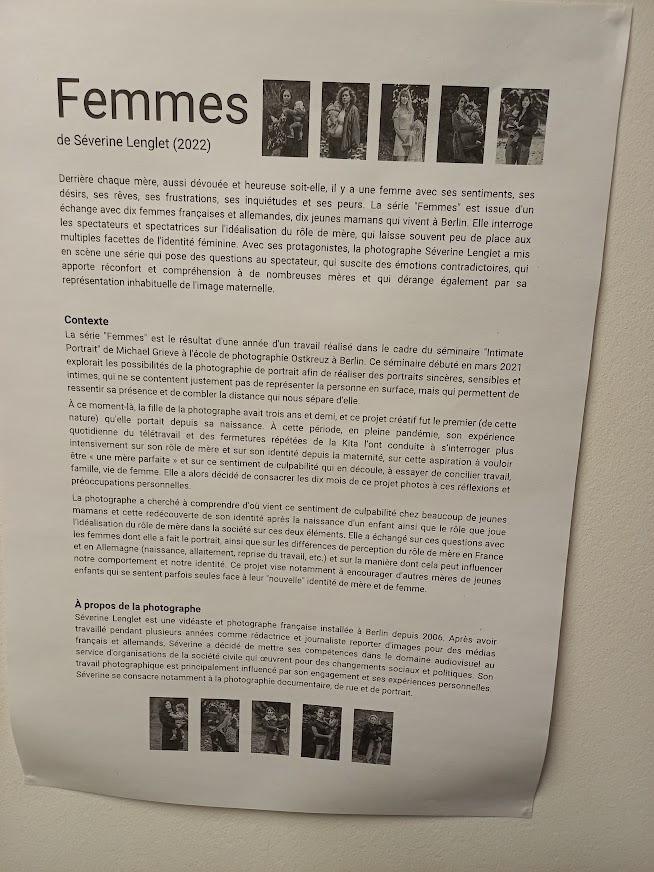Der perpetuus motus animi, in welchem laut Cicero das Wesen der Beredsamkeit besteht, hält mich früh und spät am Laufen, Denken und Nachsinnen! Manchmal weiß ich mir bei meinen Hypothesen dabei keinen anderen Rat – ich will die Antwort sofort haben! So auch heute Abend. Und so gab ich nach kurzem Überlegen bei einer bekannten künstlichen Intelligenz meine folgende Frage ein:
„Weltweit sinken die Geburtenraten. Ich vermute, dass sinkende Geburtenraten in einer Gesellschaft mit höherem Wohlstand, also höherem Durchschnitteinkommen korrelieren. In den ärmsten Ländern werden mehr Kinder pro Frau geboren, in den reicheren Ländern mit höherem Wohlstand geht die Fertilität nach unten. Stimmt meine Vermutung?“
Folgende Antwort von ChatGPT (Open AI) kam nach 3 Sekunden:
Deine Vermutung entspricht tatsächlich einem sehr gut belegten Zusammenhang in der Demografie. Was du beschreibst, ist ein zentrales Muster der sogenannten „demografischen Transition“:
1. Allgemeiner Zusammenhang
- Arme Länder (niedriges Pro-Kopf-Einkommen):
- Hohe Fertilität (viele Kinder pro Frau)
- Gründe: Kinderarbeit trägt zum Familieneinkommen bei, geringere Bildung der Frauen, kaum Zugang zu Verhütung, hohe Kindersterblichkeit (mehr Geburten als Absicherung).
- Reiche Länder (hohes Pro-Kopf-Einkommen):
- Niedrige Fertilität (oft unter 2,1 Kinder pro Frau)
- Gründe: Bessere Bildung, Berufstätigkeit der Frauen, Kosten für Kinder steigen, Individualisierung, Zugang zu Verhütung, soziale Absicherung ersetzt die „Rentenfunktion“ der Kinder.
2. Demografischer Übergang
In der Forschung spricht man vom demographischen Übergang:
- Phase: Hohe Geburtenrate + hohe Sterblichkeit
- Phase: Sterblichkeit sinkt → Bevölkerung wächst schnell
- Phase: Geburtenrate sinkt (Wohlstand, Bildung, Verhütung)
- Phase: Niedrige Geburtenrate und niedrige Sterblichkeit (Europa, Japan)
- Phase (teils): Geburtenrate dauerhaft unter 2,1 → Bevölkerung schrumpft.
3. Datenbeispiele
- Niger (armes Land): ca. 6,7 Kinder pro Frau
- Deutschland: ca. 1,5 Kinder pro Frau
- Japan: ca. 1,3
- USA: ca. 1,6–1,7
4. Ausnahmen
- Manche reiche Golfstaaten haben wegen Kultur und Migration etwas höhere Raten.
- Einige ärmere Länder wie Bangladesch haben schon stark sinkende Raten durch Bildung und Familienplanung.
Fazit
Es gibt eine starke negative Korrelation zwischen Pro-Kopf-Einkommen und Fertilitätsrate.
Dieser Zusammenhang ist eines der robustesten Ergebnisse der Bevölkerungsforschung.
Weltweit sinken die Geburtenraten – und das ist kein Zufall. In den Statistiken zeigt sich sehr klar ein Zusammenhang zwischen dem Wohlstand einer Gesellschaft und der Zahl der Kinder, die Frauen im Durchschnitt bekommen.
In ärmeren Ländern, wo das durchschnittliche Einkommen niedrig ist, bekommen Frauen oft viele Kinder. Das hat mehrere Gründe: Kinder tragen dort häufig zum Familieneinkommen bei, es gibt weniger Zugang zu Bildung und Verhütungsmitteln, und eine hohe Kindersterblichkeit sorgt dafür, dass Familien mehr Kinder bekommen, um sich abzusichern.
Mit steigendem Wohlstand verändert sich dieses Bild. In reicheren Ländern, wo die Kindersterblichkeit sinkt und der Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Verhütungsmitteln besser wird, entscheiden sich Paare für weniger Kinder. Hinzu kommt, dass Kinder mehr kosten, Frauen häufiger berufstätig sind und soziale Sicherungssysteme die „Absicherungsfunktion“ von Kindern ersetzen.
Diese Entwicklung wird in der Demografie als „demografischer Übergang“ bezeichnet. Historisch durchlaufen Gesellschaften dabei mehrere Phasen: Zunächst gibt es hohe Geburten- und Sterberaten. Dann sinkt die Sterblichkeit, was zu starkem Bevölkerungswachstum führt. Schließlich sinkt auch die Geburtenrate – bis Gesellschaften in einem Gleichgewicht mit niedrigen Geburten- und Sterberaten ankommen. In vielen Industrieländern liegt die Geburtenrate heute sogar unter dem sogenannten Bestandserhaltungsniveau von 2,1 Kindern pro Frau.
Die Zahlen machen das deutlich: In Niger liegt die Geburtenrate bei rund 6,7 Kindern pro Frau. In Deutschland sind es etwa 1,5, in Japan sogar nur 1,3. Die USA liegen bei etwa 1,6 bis 1,7.
Zwar gibt es Ausnahmen – zum Beispiel einige Golfstaaten oder ärmere Länder wie Bangladesch, in denen die Geburtenrate trotz niedrigen Einkommens schon stark zurückgegangen ist –, aber insgesamt gilt: Je höher das Pro-Kopf-Einkommen eines Landes, desto niedriger ist im Durchschnitt die Zahl der Geburten pro Frau.
Dieser negative Zusammenhang zwischen Wohlstand und Geburtenrate gehört zu den am besten belegten Phänomenen der Bevölkerungsforschung.
Beispielwerte der Fertilitätsraten (2023, gerundet):
- Niger: 6,7 Kinder pro Frau
- Bangladesch: 2,0
- Indien: 2,1
- Brasilien: 1,7
- Deutschland: 1,5
- Japan: 1,3
- USA: 1,7

(Quelle: ChatGPT, OpenAI – Antwort vom 25. Juli 2025)