Die Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten war für mich ein Anlass großer Freude. Umso mehr, als ich mich gerade in den letzten Wochen geradezu Tag und Nacht mit der Geschichte Russlands befasst hatte, eines Landes, das mühsam seinen Weg zu den Idealen der Freiheit, des Rechtsstaates und der Demokratie geht. Zu Idealen also, die in den USA seit 1776 anerkannt werden, für die in allen Generationen Männer und Frauen gekämpft haben. Es sind Ideale, auf die man sich immer wieder zurückbesinnen muss.
Ich las über die vergangenen Wochen Lenin, Rosa Luxemburg, Stalin, Marx im russischen und deutschen Original. Eine bedrückende Lektüre – nicht zuletzt auch deswegen, weil diese Autoren – neben aller berechtigten Kritik an unhaltbaren Zuständen – für den Terror, für Mord an politischen Gegnern eintreten. Noch bedrückender war es für mich zu erfahren, dass gerade in diesen Tagen wieder zwei politische Morde in Moskau geschehen sind. Die Opfer heißen Stanislaw Markelow und Anastasija Baburowa – beide politisch engagiert, beide auf offener Straße erschossen. Das ist verheerend für die politische Kultur des Landes – so wie es auch verheerend in der Weimarer Republik war, wo ebenfalls tausende politische Morde verübt wurden.
Als um so erhebender und begeisternder empfinde ich das, was in diesen Tagen in den USA geschieht.
Übrigens: In den USA ist Religionsunterricht an staatlichen Schulen gesetzlich verboten. Der Staat soll sich nicht in die freie Religionsausübung einmischen und darf deshalb den Unterricht in Religion nicht überwachen. Dennoch – oder gerade deswegen – spielt Religion im öffentlichen Leben der USA ein weitaus größere Rolle als bei uns in Deutschland. Dies wurde gestern bei der Amtseinführung wieder überdeutlich. Der neue Präsident hat sich wiederholt und ausdrücklich als Christ bekannt. Ob die eifrigen Verfechter von „Pro Reli“ dies wissen? Sollten sie noch einmal über ihren Spruch „Es geht um die Freiheit“ nachdenken?
Heute las ich die ersten Seiten von Obamas Buch „Dreams from my father“. Wie schon bei seinen Reden zeigt sich: Er ist ein Meister des Wortes – sowohl geschrieben wie gesprochen. Einer seiner Berater hat im Fernsehen gesagt: „Er ist ein Worteschmied – bosselt tagelang an seinen Reden herum, etwa wenn er sagt: Da ist noch eine Silbe zuviel, das klingt noch nicht …“
Um so neugieriger wurde ich, als ich das Motto seines ersten Buches las: „For we are strangers before them, and sojourners, as were all our fathers.“ Es ist ein Zitat aus der Jüdischen Bibel (dem „Alten Testament“ der Christen), Erstes Buch Chronik, Kapitel 29, Vers 15: „Denn wir sind Fremde vor dir, Menschen ohne Bürgerrechte wie alle unsere Väter.“ So lässt sich der Vers aus der Septuaginta, der griechischen Fassung der Jüdischen Bibel, übersetzen. In Obamas Buch steht „Fremde vor ihnen„, nicht „Fremde vor dir“ … Ich schlage in meiner englischen Bibel nach: „For we are strangers before thee, and sojourners, as all our fathers were.“
Ob nun „vor dir“ oder „vor ihnen“ – Obama hat den ungeheuren Reichtum der Bibel erkannt, beruft sich mehr oder minder deutlich immer wieder auf Grundsätze seiner Religion. Vor allem scheint ihn zu faszinieren, dass die christliche Bibel die lange Geschichte der Schwachen, der Fremden, der Verlierer aufbewahrt. So waren denn seine Bezugnahmen auf Gott in seiner Antrittsrede vollkommen glaubwürdig, glaubwürdig wie die Bezugnahme auf die vielen amerikanischen „Gründerväter“, die ebenfalls aus der Erfahrung von Unterdrückung und Bevormundung kamen. Die Bibel ermöglicht es auf unvergleichliche Weise, sich in die lange Reihe der Ausgestoßenen, der Verlierer, der Bürger zweiter Klasse hineinzuversetzen.
Obama hat es in seinen Worten gestern noch einmal ausgedrückt: Die USA sind die Heimstätte für all jene geworden, die glauben, dass jede und jeder ein Recht hat dazuzugehören – unter der Voraussetzung, dass die Ideale der Freiheit und der Gleichberechtigung allen zugute kommen. Für diese Voraussetzung gilt es Tag um Tag zu kämpfen.
 Das folgende Interview hätte ich gerne bei meiner Ankunft am Flughafen Schönefeld gegeben:
Das folgende Interview hätte ich gerne bei meiner Ankunft am Flughafen Schönefeld gegeben:




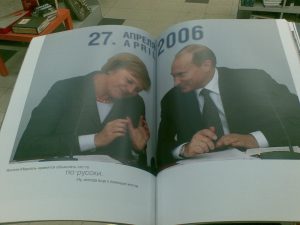

 Fernsehen und auch Radio scheinen im heutigen Russland eine viel wichtigere Rolle zu spielen als Zeitungen. Und so nutzte auch ich bei diesem Aufenthalt jede Gelegenheit, um mir einen Eindruck von den Bildern zu verschaffen, die Tag um Tag in die russischen Haushalte flimmern. Gleich am ersten Abend nach unserer Ankunft erlebte ich eine denkwürdige Diskussion mit:
Fernsehen und auch Radio scheinen im heutigen Russland eine viel wichtigere Rolle zu spielen als Zeitungen. Und so nutzte auch ich bei diesem Aufenthalt jede Gelegenheit, um mir einen Eindruck von den Bildern zu verschaffen, die Tag um Tag in die russischen Haushalte flimmern. Gleich am ersten Abend nach unserer Ankunft erlebte ich eine denkwürdige Diskussion mit:  Foto zeigt einen Eindruck von meinem Neujahrsspaziergang. Er führte mich zusammen mit den zwei Hunden Rita und Kusja und meinem jüngeren Sohn an den Ufern des Flusses Moskwa entlang. Es herrschte klirrender Frost, Eiskristalle blitzten und spiegelten, dass es eine Lust war! Wir feierten Neujahr in einer Datscha an der Rubljowka-Straße – mitten in jener Gegend, welche die geistige und politische Elite Moskaus seit Jahrzehnten für Wochenende und Ferien auserkoren hat – von Swjatoslaw Richter über den Wirtschaftswissenschaftler Kondratieff bis hin zu Jelzin und Putin … e tutti quanti. Die häufigen Straßensperrungen belegen, wie wichtig diese Leute sind. Dank meiner zwei Hunde kam ich immer wieder in kurze lockere Gespräche mit anderen Spaziergängern und tauschte Neujahrsgrüße aus.
Foto zeigt einen Eindruck von meinem Neujahrsspaziergang. Er führte mich zusammen mit den zwei Hunden Rita und Kusja und meinem jüngeren Sohn an den Ufern des Flusses Moskwa entlang. Es herrschte klirrender Frost, Eiskristalle blitzten und spiegelten, dass es eine Lust war! Wir feierten Neujahr in einer Datscha an der Rubljowka-Straße – mitten in jener Gegend, welche die geistige und politische Elite Moskaus seit Jahrzehnten für Wochenende und Ferien auserkoren hat – von Swjatoslaw Richter über den Wirtschaftswissenschaftler Kondratieff bis hin zu Jelzin und Putin … e tutti quanti. Die häufigen Straßensperrungen belegen, wie wichtig diese Leute sind. Dank meiner zwei Hunde kam ich immer wieder in kurze lockere Gespräche mit anderen Spaziergängern und tauschte Neujahrsgrüße aus. … so hielt Annette von Droste-Hülshoff am letzten Tag des Jahres inne. So halte auch ich in den letzten Stunden des alten Jahres 2008 inne. Wir bereiten uns hier auf das größte in Russland gefeierte Fest vor: Neujahr.
… so hielt Annette von Droste-Hülshoff am letzten Tag des Jahres inne. So halte auch ich in den letzten Stunden des alten Jahres 2008 inne. Wir bereiten uns hier auf das größte in Russland gefeierte Fest vor: Neujahr. Schon zwei Wochen lang besuchen wir nun die Grundschule am Brandenburger Tor – eine staatliche Europaschule, mit den beiden Unterrichtssprachen Deutsch und Russisch. Was für ein Stolz! Jeden Tag die Auseinandersetzung: „Wer darf ihn bringen? Wer darf ihn holen?“ Ich genieße es, die Klassenzimmerluft zu schnuppern. Kinder zu haben, bedeutet für mich, dass ich Tag um Tag wieder eintauchen kann in das beglückende Gefühl, wieder von vorne anzufangen.
Schon zwei Wochen lang besuchen wir nun die Grundschule am Brandenburger Tor – eine staatliche Europaschule, mit den beiden Unterrichtssprachen Deutsch und Russisch. Was für ein Stolz! Jeden Tag die Auseinandersetzung: „Wer darf ihn bringen? Wer darf ihn holen?“ Ich genieße es, die Klassenzimmerluft zu schnuppern. Kinder zu haben, bedeutet für mich, dass ich Tag um Tag wieder eintauchen kann in das beglückende Gefühl, wieder von vorne anzufangen. Der Urlaub im türkischen Kadikalesi nahe Bodrum brachte wunderbare Begegnungen, Entspannung, Spaß, Freude mit meinen russischen Schwiegereltern, aber leider auch den furchtbaren Schatten des Kaukasuskrieges, der sich über die letzte Woche legte. Wir kennen viele Georgier, die Georgier gelten in Russland als lustiges, lebensfrohes Völkchen, über das endlose Anekdoten kursieren. Und dann das! Längere Sitzungen am Internet waren unvermeidlich. Meine Türkischkenntnisse besserten sich rapide – jede Woche ein neues Wort! Unsterbliche Dialoge entspannen sich – auf russisch und türkisch gemischt, da ich als Russe galt und am „Russentisch“ saß, wie das Gevatter Thomas Mann genannt hätte. Einen dieser Dialoge will und darf ich euch nicht vorenthalten:
Der Urlaub im türkischen Kadikalesi nahe Bodrum brachte wunderbare Begegnungen, Entspannung, Spaß, Freude mit meinen russischen Schwiegereltern, aber leider auch den furchtbaren Schatten des Kaukasuskrieges, der sich über die letzte Woche legte. Wir kennen viele Georgier, die Georgier gelten in Russland als lustiges, lebensfrohes Völkchen, über das endlose Anekdoten kursieren. Und dann das! Längere Sitzungen am Internet waren unvermeidlich. Meine Türkischkenntnisse besserten sich rapide – jede Woche ein neues Wort! Unsterbliche Dialoge entspannen sich – auf russisch und türkisch gemischt, da ich als Russe galt und am „Russentisch“ saß, wie das Gevatter Thomas Mann genannt hätte. Einen dieser Dialoge will und darf ich euch nicht vorenthalten: