Mehr zufällig war ich gestern im Zusammenhang mit der Bismarckschen Sozialversicherung auf sein Wort „Staatssozialismus“ gestoßen. Das gestern angeführte Zitat fand ich in der vortrefflichen Gesamtdarstellung „Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte 1806-1933“, S. 250. Verfasser Heinrich August Winkler gelingt es in diesem meisterhaft komponierten Werk, alle gängigen Vorurteile und fromme Wahnvorstellungen, von denen unser gemeinhistorisches Bewusstsein lebt, sachte zu entstauben und eben auch die eine oder andere Tretmine sorgsam verpackt einzubauen.
Bismarck eignet sich hervorragend dazu, unsere Vorurteilsverhaftung anschaulich zu machen. Mein grob geschnitztes Bild von Bismarck war eigentlich: Eiserner Kanzler, genialer Diplomat, Machtpolitiker, schuf durch Kriege den deutschen Nationalstaat, Vertreter des Obrigkeitsstaates, alles andere als ein Demokrat, schuf sein bleibendes Verdienst mit dem System der Sozialversicherung, Unterdrücker der Sozialisten und der katholischen Zentrumspartei, wurde leider von dem törichten Kaiser Wilhelm II. ausgebootet.
Heute las ich in der Bismarck-Biographie von Lothar Gall und in Bismarcks eigenen „Gedanken und Erinnerungen“. Ergebnis: Die oben angeführten Urteile sind nicht völlig falsch, aber sie greifen zu kurz.
Gall vertritt die Ansicht, dass Bismarck aus machtpolitischem Kalkül heraus in Beratungen mit Vertretern der Industrie die Idee einer allgemeinen Versicherung unter staatlicher Obhut und staatlicher Beteiligung ersann. Ziel war, in Bismarcks Worten: „in der großen Masse der Besitzlosen die konservative Gesinnung zu erzeugen, welche das Gefühl der Pensionsberechtigung mit sich bringt.“ Denn: „Wer eine Pension hat für sein Alter, der ist viel zufriedener und viel leichter zu behandeln, als wer darauf keine Aussicht hat“ (Gall, a.a.O. S. 605).
Bismarcks Konzept stieß auf heftigsten Widerstand bei den Linskliberalen, dem Zentrum und der Sozialdemokratie. Sie fürchteten „einen auf staatssozialistische und pseudeoplebiszitäre Elemente gestützten Neoabsolutismus“ (Gall, a.a.O. S. 606).
Und was erwiderte Bismarck auf solche Anfeindungen? Er zeigte sich erneut als der geniale Politiker, der er war – er verbat sich solche Unterstellungen nicht, sondern unterlief sie durch Zustimmung. Bismarck führte aus: „Die sozial-politische Bedeutung einer allgemeinen Versicherung der Besitzlosen wäre unermeßlich.“ Erneut verwendet er den Begriff Staatssozialismus, der ihn in der Tat zu einem Ideengeber der heutigen Linken (etwa in den Personen eines Björn Böhning oder einer Halina Wawzyniak) werden lässt.
Bismarck sagt über seine Sozialversicherung:
„Ein staatssozialistischer Gedanke! Die Gesamtheit muß die Unterstützung der Besitzlosen unternehmen und sich Deckung durch Besteuerung des Auslandes und des Luxus zu verschaffen suchen.“
Das ist die Reichensteuer, das ist der Protektionismus durch Handelshemmnisse, wie sie gerade jetzt wieder als Gedanken im Schwange sind!
Wie bewertet Gall Bismarcks Leistung beim Aufbau des Sozialstaates? Niederschmetternd! Er deutet sie nicht als bleibendes Verdienst oder systematisches Aufbauwerk, sondern als einen politischen Verzweiflungskampf, der das Wesen der Politik dauerhaft entstellt habe. Letztlich habe Bismarcks Kampf um die eigene Machtposition dazu geführt, dass man sich nur noch am Machbaren orientiere und Perspektivlosigkeit zum Prinzip erhoben habe (Gall, a.a.O. S. 607). Das herrliche Wort Perspektivlosigkeit – ich glaube, etwa ab den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts hat es eine steile Karriere hingelegt, die bis zum heutigen Tage anhält! Es gibt heute kaum ein schlimmeres Urteil als eben dies: Perspektivlosigkeit.
In solchen Kommentaren schlägt das Politikverständnis des Historikers Gall deutlich durch. Politik hätte demnach sich nicht am Machbaren zu orientieren, sondern den großen Wurf durchzuführen. Es ginge laut Gall dann bei guter Politik darum, Verhältnisse, Strukturen und Verhaltensweisen bewusst zu gestalten.
Und hier gewinnen seine Ausführung beklemmende Aktualität. Denn das sind heute noch die Pole, zwischen denen sich Politik bewegt: Politik entweder als Kunst des Machbaren – oder als kühner Ausgriff, als bewusst angelegte Reform.
Wenn man Bismarck studiert, wird man erkennen: Die bewusst angelegten, raumgreifenden Reformen sind sehr, sehr selten, die meisten gut gemeinten Reformen versanden oder bleiben auf halbem Wege stecken. Oder sie werden irgendwann zu einer Erblast.
Vergleicht man aber Bismarck mit dem durchaus geistesverwandten russischen Ministerpräsidenten Stolypin, so wird man sagen müssen: Der erste deutsche Kanzler hat – im Gegensatz zu vielen anderen Reformern – einen Teil seiner Neuerungen durchaus zu einem bleibenden Reformwerk gestaltet. Dass seine Motive eigennützig waren, letzlich auch der eigenen Machtsicherung dienten, verschlägt nichts daran, dass die Sozialversicheurng Elend und Leiden minderte, Bindekräfte zwischen Staat und Bürgern entfaltete und gewaltsame Revolutionen wie etwa in Russland verhinderte.
Dass wir heute noch quer durch alle Parteien am Erbe des Bismarckschen Obrigkeitsstaates leiden, ist nicht Bismarck anzulasten – sondern uns! Man muss dies durchschauen. Wenn es etwa heißt: „Wir dürfen keine systemische Bank in den Konkurs treiben“, „Wir dürfen Opel nicht pleite gehen lassen“, dann zeigt sich genau jenes paternalistisch-obrigkeitliche Denken eines Bismarck wieder, das ich für schwer vereinbar mit einer freiheitlichen Demokratie im Sinne unseres Grundgesetzes halte.
In den Reformdebatten unserer Zeit – etwa seit den Leipziger Reformbeschlüssen der CDU von 2005 – wird dieser Zusammenhang zwischen Machterhaltung und Reform meist gegeneinander ausgespielt. Es heißt grob vereinfacht: „Wir müssen unsere Reformvorstellungen dem Machterhalt opfern. Das große Ding können wir nicht drehen. Der Zeitpunkt ist vorüber.“
Ich halte dies für einen Irrtum. Machterhalt und Reform sollten einander gegenseitig bekräftigen. Dass dies möglich ist, hat Bismarck meines Erachtens glänzend vorgeführt. Ich teile deshalb die ernüchternd-entzaubernde Ansicht Lothar Galls, wonach Bismarck lauter verzweifelte Rückzugsgefechte gekämpft habe, nicht. Solche Tretminen, die das Denkmal Bismarck beschädigen, sind keine.
Schade, dass die großen Politiker wie etwa Bismarck oder Stolypin so vernachlässigt werden und statt dessen sehr viel mehr Fleiß auf politische Propheten wie Rosa Luxemburg, Dichter wie Karl Marx, Diktatoren oder politische Verbrecher wie Stalin und Hitler verwendet wird! Schade, dass unsere Politiker quer durch die Parteien offenkundig meinen, sie stünden vor komplett neuen Herausforderungen und Problemen! Rückbesinnung tut not!
Folgende Bücher empfehle ich heute nachdrücklich als Gegengift gegen diese Extremismus-Besessenheit und diese Geschichts-Vergessenheit:
Lothar Gall: Bismarck. Der weiße Revolutionär. Ullstein Verlag, Frankfurt am Main, 1980
Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. Ungekürzte Ausgabe. Herbig Verlag, München, o.J.
Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte 1806-1933. Sonderausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2002
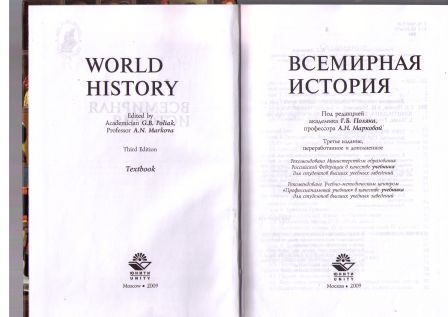


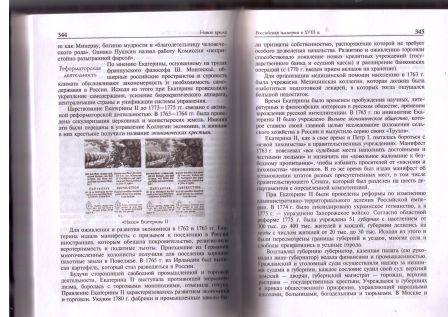

 Fernsehen und auch Radio scheinen im heutigen Russland eine viel wichtigere Rolle zu spielen als Zeitungen. Und so nutzte auch ich bei diesem Aufenthalt jede Gelegenheit, um mir einen Eindruck von den Bildern zu verschaffen, die Tag um Tag in die russischen Haushalte flimmern. Gleich am ersten Abend nach unserer Ankunft erlebte ich eine denkwürdige Diskussion mit:
Fernsehen und auch Radio scheinen im heutigen Russland eine viel wichtigere Rolle zu spielen als Zeitungen. Und so nutzte auch ich bei diesem Aufenthalt jede Gelegenheit, um mir einen Eindruck von den Bildern zu verschaffen, die Tag um Tag in die russischen Haushalte flimmern. Gleich am ersten Abend nach unserer Ankunft erlebte ich eine denkwürdige Diskussion mit: 

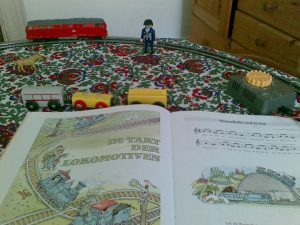 Was heißt eigentlich: „
Was heißt eigentlich: „